Die übliche Begegnung in Corona-Zeiten findet auf virtuellem Wege statt. So lernen sich der als Kunsthistoriker ausgebildete Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen Bernhard Maaz und der Dramaturg und Werkleiter von JenaKultur konsequenterweise gleich am Telefon kennen. Zumindest eines haben sie schon auf den ersten Blick gemeinsam: Die biografischen Stationen Jena und München. Aber auch darüber hinaus gibt es Einiges zu besprechen: Ein Gespräch über Werte-Gemeinschaft und ihre Zerreißprobe in der Krise, über den Stellen-Wert von Kunst innerhalb dieser Gemeinschaft, sowie über einen großen Biergarten und eine kleine Rose…
JONAS ZIPF: Servus, Herr Maaz.
BERNHARD MAAZ: Servus. Kurzes Schweigen Wie kommen Sie auf „Servus“?
JONAS ZIPF: Ich habe in München studiert. An der Everding[1] habe ich Musiktheater-Regie gelernt. Und meine Frau kommt aus München. Diese Stadt ist für mich eine echte Wahlheimat. Und außerhalb der Corona-Zeiten sind wir alle zwei, drei Monate dort. Von daher ist mir die Stadt gewohnt und vertraut. Und ich freue mich, wenn man ein Gespräch mit „Servus“ beginnt und es mit „Pfiat Eana“ oder „Pfiat Di“ beendet. Ist eine Lebensart.
BERNHARD MAAZ: So ist es. Ja, ich bin auch ganz gerne hier.
JONAS ZIPF: Sie kommen ja aber ursprünglich aus Jena?
BERNHARD MAAZ: Ja, genau. Aber das sind Ursprünge, die durch Zufall so gekommen sind. Meine Eltern stammen aus Siebenbürgen und dem, was man das Sudetenland nannte. Sie wurden vertrieben, kamen nach Thüringen in die damaligen Auffanglager und haben dann in Jena studiert und sich kennengelernt. Und so bin ich eigentlich ein Deutscher, der das gesamte deutsche Sprachgebiet ‚im Blut‘ oder im Blick hat. Aber das Jena-Thüringische – den Slang – habe ich nie wirklich beherrscht.
JONAS ZIPF: Wie viel Zeit Ihres Lebens haben Sie denn letztlich hier verbracht?
BERNHARD MAAZ: 18 Jahre.
JONAS ZIPF: Und sind dann weggegangen zum Studium?
BERNHARD MAAZ: Exakt. Ein Jahr Weimar, dann fünf Jahre Studium in Leipzig. Dann 23 Jahre Vollzeitberliner mit Job in Berlin. Dann fünf Jahre Halbzeitberliner mit Job in Dresden. Und jetzt schon wieder fünf Jahre und ein paar Monate München, ausschließlich.
JONAS ZIPF: Beim Lesen Ihres Werdegangs musste ich an den Roman „Verwirrnis“ von Christoph Hein denken. Kennen Sie den?
BERNHARD MAAZ: Nein.
JONAS ZIPF: Es wird ja nun durchaus schon seit längerem darüber diskutiert, ob es einen „großen“ ostdeutschen Roman gibt, der die gesellschaftliche Geschichte der DDR reflektiert. Ich finde, das ist er. „Verwirrnis“ hat mich wirklich begeistert. Und da kommen eben auch die Universitätsstädte Jena und Leipzig vor. So wie Sie macht der Protagonist den entscheidenden Schritt von Jena nach Leipzig, vom kleinen närrischen Universitätsdorf in die große Stadt. Im Vordergrund erzählt der Roman die Geschichte von zwei sich heftig liebenden Homosexuellen, die aus dem katholischen Eichsfeld stammen, und ihre Liebe in diesem kleinbürgerlichen Staat und seiner engstirnigen Gesellschaft verstecken müssen.
BERNHARD MAAZ: Es gibt ja so manchen markanten Text über die DDR. Ich habe mal angefangen, Uwe Tellkamps „Der Turm“ zu lesen, und das Buch nach zwei, drei Dutzend Seiten wegen geschraubter und gestelzter Sprache, unsäglicher und eitler Selbstdarstellung beiseitegeschoben.
Ich bin vielleicht noch nicht alt genug, um wirklich nach den Wurzeln zu suchen. Zumal ich meine Wurzeln ja als Luftwurzeln beschreiben müsste, um mal ins Fach der Botanik zu greifen.
JONAS ZIPF: Ja, ich finde, dass viele autobiografische Beschäftigungen der letzten Jahre sehr eitel sind. Nicht nur die von Tellkamp. Gerade deshalb sticht der Christoph-Hein-Roman so hervor: Der möchte gar nicht vordergründig die Gesellschaftsgeschichte erzählen und kommentieren. Das passiert eher so en passant, indem der Autor seine Figuren liebt und deren Geschichte erzählt. Er beherrscht einfach sein Handwerk, stürzt sich nicht selbstverliebt in die Stilistik. Das hat mich sehr beeindruckt.
BERNHARD MAAZ: Zu Ihrer Beschreibung passt Marcel Beyers „Kaltenburg“. Auch ein zupackender, ein unaufgeregter Roman über Dresden. Quasi das Anti-Dresden zum „Turm“, viel tiefer geerdet, viel realistischer. Und doch schon lange vorbei. Beim Lesen solcher Bücher kommt es mir so vor, als ob die Distanz wächst. Die Notwendigkeit, die Gegenwart zu betrachten, wird langsam größer angesichts der monumentalen Themen unserer Zeit.
JONAS ZIPF: Also, ich sehe da schon Verbindungen, Bögen. Ich möchte mit Ihnen über Gemeinschaft reden. Unsere Zeit ist ja eine Zeit, die uns, wie ich finde, die Frage abverlangt, ob wir diese Gesellschaft überhaupt noch als Gemeinschaft erleben. Solidarität ist nicht zufälligerweise das Wort der letzten Krise. Im Kern geht es darum, ob wir als Gemeinschaft bestehen oder ob wir in Einzelinteressen zerfallen, in eine Kakofonie von einzelnen Partikular-Lobbies. Und ich glaube, dass die Zeit vor und rund um 1989 deswegen nochmal viel näher gerückt ist: Weil es eine gewisse Sehnsucht nach Orten oder Momenten gibt, in denen Gesellschaft stattfindet. Dahinter steckt letztlich die Frage nach dem Verhältnis zwischen Gemeinschaft und Staat. Damals wie heute stellt sich die Frage: Ist der Staat in der Lage, eine gesellschaftliche Gemeinschaft abzubilden? Ein bisschen so wie 2015. „Wir schaffen das“, hat die Kanzlerin gesagt. Es gab einen kurzen Zeitraum, in dem alle zusammengerückt sind und die Ärmel hochgekrempelt und versucht haben, die Krise gemeinsam zu bewältigen. Und dann gab es jahrelange Auseinandersetzungen darüber, wer die entstandenen Rechnungen zahlt, die finanziellen, aber auch die politischen, juristischen, moralischen. Und so ähnlich verläuft die aktuelle Krise auch. Am Anfang gab es wieder diesen Moment; alle rückten zusammen. Und jetzt zerfällt und zerfasert das zunehmend. Wir befinden uns mitten in einem Lehrstück darüber, ob wir es schaffen als Gemeinschaft, als Gesellschaft zu bestehen oder ob wir wieder zerfallen in alle möglichen einzelnen Stimmen.
BERNHARD MAAZ: 2015 hat man gehört: „Wir schaffen das“. Danach, ein Jahr später hätte man sagen müssen: „Wir hätten das gerne geschafft“. Und nochmal drei Jahre später, also heute, kann man sagen: „Oh, wir haben es ja doch geschafft!“ Wir haben es geschafft. Noch nicht restlos, aber es bleibt in der Gesellschaft bei jedem Thema, was wir lösen, auch immer ein ungelöster Rest. Es gibt immer Gewinner und Verlierer, und es gibt immer zwischen diesen beiden Polen unendlich viele Nuancen. — Jetzt will ich auf die Gegenwart schauen, auf die Frage der Solidarität. Die ganze Gesellschaft ist ja jüngst erst einmal in die Fragmentierung geschleudert worden. Jeder erlebt das als Einzelner und für sich. Die Solidarität wurde jetzt ab März 2020 etwa in den Krankenhäusern gelebt, wo wirklich brutale Fälle von Corona aufgetreten sind und unerbittliche Folgen auch für die Belegschaft zu sehen waren. Wenn ich andererseits unsere Kultureinrichtungen sehe, dann muss ich gestehen: Der Einschlag der Schließung kam nicht so unvorhergesehen, wie man vielleicht im Nachhinein denkt. Es hatte sich ja schon im Februar gezeigt, dass die Epidemie sich in eine Pandemie verwandelt; es hatte sich da schon gezeigt, dass die Besucherzahlen signifikant zurückgingen, dass sich das (Reise-)Verhalten der Menschen änderte, dass Ängste aufkeimten, dass man vermeidbare Reisen nicht mehr antreten wollte – und all das. Und die Solidarität setzte eigentlich meiner Erfahrung zufolge erst mit einer gewissen Verzögerung nach dem Shutdown ein – erst, als wir die Fragestellung ändern konnten von „Was passiert jetzt mit uns?“ zu „Was muss passieren, damit wir wieder zu einer Gemeinschaft, einer Solidargemeinschaft werden?“ Für mich war das eine Sinuskurve, deren Nullpunkt lange hinter dem Shutdown lag, und die sich nun danach aufwärtsbewegt. Es entstand ein Blick nach vorne. Wir fragten uns, wie wir die Museen wieder öffnen können, wie das insgesamt mit der Gesellschaft um uns herum weitergeht, was zu tun und wie zu handeln ist. Gleichzeitig stiegen die Fallzahlen noch, die Gefahr wurde größer – eine Gefahr, die im Grunde durch den Staat gebannt worden ist – und durch die überraschend starke und wunderbare Solidarität der Menschen. Die Gemeinschaft spielte, glaube ich, eine große Rolle: als Umsetzungsinstrumentarium dessen, was der Staat beschlossen hat, damals noch einheitlich gesamtdeutsch, nunmehr längst fragmentiert, über alle Bundesländer hinweg diversifiziert.
JONAS ZIPF: Ich habe das als einen Kipppunkt erlebt. Bis vor vier Wochen ungefähr gab es diese merkwürdige Einigkeit, dass die Ministerpräsidenten, deren Souveränität es ja ist, Infektionsschutz zu gewährleisten, sich abstimmen mit der Bundesebene. Diese Telefonkonferenzen hatten ja schon fast etwas von päpstlicher Synode. Alle haben darauf hingefiebert und spekuliert, was da jeweils rauskommt. Und tatsächlich sind ja relativ wenig restriktive Maßnahmen verabredet worden. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt eine Ausgehsperre wie in Italien oder Österreich. Das meiste waren Gebote, keine Verbote. Und viele Leute haben sich vernünftig gezeigt, sich daran gehalten, und es ist relativ einheitlich gelaufen. Und dann gab es diesen Kipp-Moment. Die Vorboten konnte man, glaube ich, schon an dem Partikularverhalten der beiden Ministerpräsidenten in Bayern und in Nordrhein-Westfalen mit ihrem verdeckt geführten Machtkampf in Antizipation der Kanzlerfrage auf sich zukommen sehen. Plötzlich ist diese Einmütigkeit zwischen den Landesfürsten zerfallen. Und nochmal zwei Wochen später hatten wir diese Situation, dass von oben nach unten durchdelegiert wird. Die meisten Länder haben ja praktisch diese Nichtabstimmung – das, was dann hastig „Regionalisierung“ getauft und als Vorteil des Föderalismus beschworen wurde – in einen Wettbewerb der Lockerungen überführt und die Verantwortung der Regelungen vor Ort einfach 1:1 auf die Kommunen weitergegeben. So, dass wir als Kommune alle Lockerungen auf einmal bewältigen mussten und unser Gesundheitsamt eigentlich nur noch die weiße Fahne raushängen konnte. Seitdem macht jeder seine Hygienemaßnahmen im Prinzip auf eigene Faust. Man könnte auch sagen, man sei vom Fahren auf Sicht – davon war ja wochenlang die Rede – zum Blindflug übergegangen. Die vernünftige Lockerung in abgestimmter Form, so war es ja mal ursprünglich vorgedacht, wäre gewesen, im Laufe des Mai die Kitas und die Schulen, einzelne Wirtschaftszweige und dann peu à peu weitere Bereiche des öffentlichen Lebens wieder hochzufahren. Und jetzt passiert das praktisch alles auf einmal und in einem Wildwuchs, in einem Wettbewerb, einem Überbietungswettbewerb, der auch für die Bevölkerung irgendwann nicht mehr verständlich ist. Vor allem nicht vor dem Hintergrund der Geschwindigkeit, mit der sie aufgefordert wurde, in den Lockdown reinzugehen und als Gemeinschaft solidarisch zu handeln. Jetzt wird die Pandemie quasi für beendet erklärt, unter anderem von unserem Ministerpräsidenten in Thüringen am letzten Wochenende. Das ist kaum noch nachvollziehbar. Und ich glaube, diese Verwirrung, oder um vielleicht bei dem Romantitel von Christoph Hein zu bleiben, diese „Verwirrnis“, sorgt jetzt für das Zerfallen in einzelne Interessensgruppen. Das Verrückte dabei: Die, die jetzt am emotionalsten reagieren, bei denen die Tonalität am meisten verrutscht, die bei uns – also bei der Stadtverwaltung – anrufen und sich bitterböse beschweren, das sind oftmals diejenigen, die eigentlich davon am wenigsten betroffen sind. Wir leben ja in einer Zeit voller Paradoxien. Die, die ganz intensiv damit beschäftigt und davon betroffen sind, deren Existenz am Rande steht, die machen auf mich überwiegend immer noch den vernünftigeren Eindruck, vielleicht weil sie sich in der Tiefe mit dem Thema beschäftigen und es wahrscheinlich daher auch ernster nehmen. Für die anderen ist es weit weg, die wollen einfach das normale Leben zurück. Sehen Sie das auch so?
BERNHARD MAAZ: Ich glaube, dass Sie da etwas ganz Wichtiges beschreiben. Diejenigen, die betroffen sind, setzen sich damit in der Tat viel stärker auseinander und behalten den Blick der Verantwortlichkeit auf das Thema. Diejenigen, die nicht betroffen sind, haben das Gefühl, dass sie nichts zu verantworten hätten – und deswegen haben sie das Gefühl, etwas fordern zu dürfen. Und das ist Wasser auf die Mühlen einer gesellschaftlichen Entwicklung, die bereits über Jahrzehnte hinweg läuft: Immer mehr Mitmenschen meinen, alle ihre Forderungen müssten gestellt und auch rasch erfüllt werden. Insbesondere gegenüber dem Staat. Für die Generation, die jetzt 20, 30 Jahre alt ist, gibt es keinerlei Krisenerfahrung. Für die Generationen, die etwas älter sind, gibt es wenigstens die Erfahrung einer großen Krise, die Erfahrung der zwei niedergebrannten Türme von New York, Nine-Eleven. Damals hat man sich geschreckt, geschüttelt und festgestellt, dass die Welt nicht so fest und stabil ist, wie vorher angenommen. Aber die noch jüngere Generation, die jetzt auch sorglos-hedonistisch auf den Wiesen sitzt und so tut, als wäre Corona schon ausgestanden, die müssen wir, glaube ich, mit der Bewusstmachung erreichen, dass auch sie in eine gesellschaftliche Verantwortlichkeit gehen werden müssen. Ich glaube, dass Worte wie „Kipppunkt“ oder „Sinuskurve“, die wir im Gespräch schon gebrauchten, das Prozessuale all dieser Vorgänge indizieren. Ich bin fest überzeugt, dass die Partikularinteressen – Stichwort dazu: diverse Ministerpräsidenten treffen unterschiedliche Entscheidungen – auch mit der verbreiteten Rücksichtslosigkeit in unserer Gesellschaft zu tun haben. Und dadurch kommen jetzt diejenigen wieder leichter nach vorn, die einfach schlicht ‚dagegen‘ sind. Wogegen? Dagegen. Gegen alles, irgendwie: Gegen die Obrigkeit, gegen Beschlüsse, gegen Restriktionen, ja zuweilen gegen alle Normierungen. Aber genau darin erweist sich dann auch wieder das gleichzeitige Verantwortungs- und Inklusionspotential einer Gesellschaft: Einerseits die Notwendigkeit, Restriktionen zu reflektieren, zu kommunizieren und im Zweifelsfalle diesen Exzentrikern trotzdem den nötigen Raum zu geben, sich zu artikulieren – ihnen und allen anderen also Pro und Kontra vorzurechnen. Diesen Dialog halte ich für sehr wichtig. Ich hatte zwischendurch einmal einen Moment, an dem ich dachte, wir seien ja gar nicht in der Krise, wir sind ja nur in der Generalprobe. Was ich damit sagen möchte: Dass es noch viel größere Krisen geben kann, und die sind nicht herbeiphantasiert. Allein die Vorstellung, dass Ebola global grassieren würde, ist so abgründig und so bedrohlich, dass wir von da aus gesehen die Corona-Krise als eine Generalprobe verstehen sollten. Corona ist eine unglaubliche Belastungsprobe und Herausforderung. Aber solche Entwicklungen haben der Menschheit auch jeweils neue Impulse gegeben.
JONAS ZIPF: Wir sprechen von einer Art Bewährungs-Probe für unsere Gemeinschaft. Daran möchte ich eine Beobachtung anschließen, die mich in den letzten Wochen stark umtreibt. Die AfD ist ja mittlerweile sehr geschickt darin, mit viel juristischer Expertise alle zu Gebote stehenden rechtsstaatlichen Mittel auszuschöpfen. Wahnwitzigerweise haben sie es im letzten Jahr fast geschafft, die gesetzlich verankerte Steuerfreiheit gemeinnütziger Organisationen gerichtlich zu kippen. Ich beobachte und erlebe, dass unsere Verfassung an dieser Stelle verwundbar ist: Aufgrund der historischen deutschen Erfahrung betont die AfD gegenüber dem Gemeingut die Individualrechte in einem Maß, die diese in Konflikt zur Gemeinschaft bringen können. Freiheit ist sozusagen wichtiger als Brüderlichkeit. In Frankreich oder in Italien existiert dagegen ein gesellschaftliches Grundverständnis, ein Gesellschaftsvertrag, der es viel leichter erlaubt, dass zum Wohle der Gemeinschaft und gegen das Recht des Einzelnen harte Entscheidungen getroffen und auch rechtsstaatlich nicht so leicht gekippt werden können. Bei uns stehen das Individuum, die Freiheitsrechte des Individuums, so hoch in der politischen Kultur, in der gesellschaftlichen Debatte, auch eben in der juristischen Auslegung, dass ein Bundestagspräsident diese Grundrechte gegeneinander in Stellung bringen kann, dass es einer AfD-Lobby gelingt, mit dem Argument der Religionsfreiheit Restriktionen zu lockern und zu kippen. In Niedersachsen mussten beispielsweise auf diese Weise erste Gottesdienste wieder stattfinden. Ein ethno-pluralistischer Treppenwitz übrigens, dass es sich dabei ausgerechnet um islamische Freitagsgebete handelte. Von diesen „Exzentrikern“, wie Sie sie genannt haben, wird dann vor allem mit Religionsfreiheit, Berufs-, Meinungs- oder Versammlungsfreiheit argumentiert. Jetzt werden polemisch, politisch, populistisch individuelle Grundrechte in Stellung gebracht gegen das, was wir als Gemeinschaft beschreiben. Es war ja eine sehr abstrakte Herausforderung, die am Anfang aber offensichtlich von der überwiegenden Mehrheit dieser Gemeinschaft geteilt wurde, die auch gut erklärt wurde, wie ich finde: Wir müssen jetzt – so hieß es immer – dafür sorgen, dass die medizinischen Kapazitäten nicht überlastet werden….
BERNHARD MAAZ: … nicht kollabieren…
JONAS ZIPF: … und das ist gelungen bis hierhin. Das ist ja ein großer Erfolg.
BERNHARD MAAZ: Ja, wahrlich.
JONAS ZIPF: Jetzt wundern sich andere Länder, die viel härtere Restriktionen und viel härtere subjektive Erfahrungen mit der Krise erleben mussten, über uns – darüber, was da auf der Straße und im Internet bei uns los ist. Und Sie haben recht: Letztlich ist das ein Ausdruck eines gesamtgesellschaftlichen Phänomens, einer Entwicklung, die schon länger anhält; letztlich könnte man von einem besorgniserregenden grundsätzlichen Misstrauen in den Staat sprechen. Vor allem aber fehlt eben ein Gefühl dafür, sich der Gemeinschaft unterzuordnen. Das bedeutet Solidarität im Kern, ja: Ich selbst bin mir nicht der Nächste, sondern ich muss mich als Teil einer Gruppe, als Teil der Gemeinschaft verstehen. Nur so können wir bestehen. Das ist der Stresstest, wenn wir über die Krise reden. Für uns als Gesellschaft in Deutschland, aber auch als europäische Gemeinschaft. Plötzlich werden sogar CDU-Abgeordnete oder FDP-Abgeordnete gehört, die sagen: Hätten wir doch mal diese europäische Union nicht nur auf den Prinzipien von wirtschafts- und finanzpolitischer Vernunft gebaut, sondern auch als Wertegemeinschaft entwickelt. In dieser Phase liegt eine ganz, ganz große Chance, als Gemeinschaft nach vorne zu kommen. Aber sie birgt auch eine riesige Gefahr, nämlich die zu zerfallen. Und Sie sagen vollkommen zurecht: Das ist gewissermaßen wie eine Generalprobe. Auch für andere noch anstehende Krisen, aber auch innerhalb dieser Krise. Wir wissen nicht, ob eine zweite oder eine dritte Welle kommt. Und wenn wir von einem Kipppunkt sprechen, jetzt schon, ich möchte es mal so sagen, dann scheint unser Vermögen im doppelten Wortsinne – also Vermögen als volkswirtschaftlich harte Münze, aber auch unser Vermögen an gemeinschaftliche geteilten Werten – einen nicht ausreichend großen Vorrat darzustellen, um diesen Stresstest zu bestehen. Das ist zumindest meine zugegebenermaßen pessimistische Sorge.
BERNHARD MAAZ: Vielleicht schlagen wir aus diesem Verdruss noch einen Funken, denn auch aus der Krise muss man einen Funken schlagen. Wer hat das doch gesagt: „Never waste a crisis!“? Wir müssen wissen, dass darin die Chance liegt. Wir müssen diskutieren, debattieren in der Gesellschaft! Es kann noch viel schlimmer kommen. Und wenn es viel schlimmer käme, wenn etwa eine zweite Welle kommt, dann wird man nicht erneut Billionen an Geldern ausschütten können. Dann hat das noch ganz andere Folgen. Im Umkehrschluss kann man im Grunde nur Aufklärung leisten und unterstreichen: Was hier geschafft wird, ist monetär eine Hypothek auf Jahre oder sogar Jahrzehnte, aber auch ein Erkenntnisgewinn, der hoffentlich ebenfalls Jahrzehnte hält. Nämlich: Man kann es mit Umsicht manövrieren, das Schiff. Das Schiff Europa ist nicht untergegangen; das Schiff Deutschland ist nicht untergegangen. Aber es hat viele, viele zehntausende Tote gegeben durch ein unvorhergesehenes, theoretisch unvorhergesehenes, Phänomen, nämlich dieses Virus. Warum sage ich „theoretisch unvorhergesehen“? Weil es praktisch vorhergesehen worden war. Es gibt ein Bundestagspapier von Anfang 2013, basierend auf Krisenmanagement-Betrachtungen des Bundestages aus dem Jahr 2012.[2] Dort heißt es, ein Virus mit dem fingierten Namen Nova SARS könne auftauchen. Man hat das Szenario der Folgen für die Gesellschaft, die Gesundheit, die Kultur etc. dort aufwendig durchgespielt, aber die Gesellschaft hat es nicht zur Kenntnis genommen. Es gab also bereits weithin kaum wahrgenommene Reflexionen rein naturwissenschaftlicher und gesellschaftlicher Art, wie ein gesamtgesellschaftliches Krisenmanagement im Fall des Falles aussehen müsste. Dieser „Bericht zur Risikoanalyse“ blieb ein theoretisches Papier – ohne Umsetzung in die Praxis, jedenfalls soweit ich erkenne.
Nun kam es etwas anders. Wir mussten und müssen die tagtäglichen Erwägungen und Vorschriften umgehend in die Praxis umsetzen. Das finde ich deswegen so spannend, weil eine Gesellschaft nie berechenbar ist. Wir haben ja jetzt schon mehrmals diesen Begriff der Wertegemeinschaft umkreist. Der ist eben nicht statisch, sondern immer dynamisch. Zunächst hieß es ja, wir sollen soziale Distanz halten. Und allein in der Formel, die da gefunden worden war, lag ja schon der Fehler: Wir sollten soziale Nähe suchen, bei gleichzeitiger räumlicher Distanz. Sprache ist immer verräterisch. Diese räumliche Distanz haben wir jetzt. Die leben wir jetzt, die meisten von uns. Bis auf diejenigen, die meinen, sie wollten es drauf anlegen. Die räumliche Distanz, die Umsicht, den Schutz, ja sogar die Fürsorge für den anderen Menschen haben wir neu eingeübt. Und nicht nur, weil wir meinen, Vorgaben oder Gesetze erfüllen zu müssen, sondern auch, weil wir meinen, für die Menschen da sein zu müssen. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Gesellschaft auch heute immer noch diese Form der empathischen, fürsorglichen Rücksichtnahme täglich und stündlich lebt. Ich erlebe es jedenfalls so.
Es gibt daneben natürlich einen kleineren Teil der Gesellschaft, den würde ich auch gar nicht politischen Lagern zuordnen, der sagt, das Virus sei ausgedacht oder zumindest egal, die Grundrechte dürfen nicht eingeschränkt werden etc. Es gibt aber neben dem Grundrecht des Individuums auch die Verantwortlichkeit für die Gesellschaft. Diesen Diskurs hat uns die Corona-Pandemie aufgezwungen. Und darin sehe ich auch einen gewissen Benefit dieser Situation, die man sich nie gewünscht hätte.
Wir müssen den Diskurs eben über die Grundrechte des Einzelnen und über die der Gesellschaft als Gemeinschaft führen. Damit sind wir dann wieder bei den Themen, die in der bildenden Kunst verhandelt werden oder auch im Theater: Über die Werte und Wertegemeinschaften. Wieso ist das überhaupt alles so dringlich, dass wir all dies diskutieren? Darauf gebe ich mir eine Antwort, die darin besteht, dass unsere Gesellschaft die christlichen, also religiösen – ich fasse das damit jetzt noch weiter – Werte verloren hat. Das sind sicherlich Spätfolgen der Aufklärung, des Rationalismus, des Skeptizismus. Wir haben sozusagen den Wertekanon der christlichen Tugenden nicht mehr normativ vor Augen: Caritas etwa, die Nächstenliebe. Wir stehen jetzt an einem Punkt, an dem wir uns diese Werte der Gesellschaft dringend wieder bewusst machen müssen. Und zwar als letztendlich nicht nur christliche oder nur jüdische Werte, sondern als menschheitliche Ethik, als Gesellschaftsvertrag auf anderem, auf philosophischem Niveau, als unverhandelbares Gut.
JONAS ZIPF: Tatsächlich muss diese Wertegemeinschaft doch aber irgendwo, irgendwie erlebt werden. Und da kommen wir wahrscheinlich jetzt ins Spiel unseres ureigenen Terrains der Kultur – Sie haben es gerade schon angedeutet – indem wir die Diskurse führen, die diese Werte verhandeln oder auch zeigen, wo die Gefahren und Begrenzungen liegen. Erstmal in einem ganz prosaischen und ganz einfachen Sinn, indem sich anhand unserer Angebote Menschen überhaupt versammeln und als Gemeinschaft erleben. Wo tun sie das noch? Beim Sport, bei der Kultur, vielleicht bei der Religion, im Freizeitverhalten im weitesten Sinne. Und darin besteht schon wieder ein Paradox – Sie haben das ja auch gerade schön beschrieben: Svenja Flaßpöhler, die Philosophin, beschrieb in einem frühen Stadium der Pandemie, wie wir uns jetzt näherkommen, indem wir auf Distanz gehen. Das ist ja kontraintuitiv. Und berührt einen ganz schmerzhaften Punkt der künstlerischen oder kulturellen Arbeit. Als wir mit der Kurzarbeit begonnen haben, wurde diese probate Maßnahme von vielen Mitarbeitern sofort als demotivierender Zungenschlag empfunden, ganz schlicht und ergreifend, da sie ihre Arbeit mit Leidenschaft versehen. Jetzt werden Lockerungen gefordert, politisch wird teilweise so getan, als ob das offene Leben prä Corona einfach wieder zurückkommen könnte. Und es entstehen entsprechende Erwartungshaltungen seitens der Bevölkerung. In Wirklichkeit beschäftigen wir uns aber mit Veranstaltungen in Sälen, die für 700 Leute ausgelegt sind…
BERNHARD MAAZ: … in denen aber momentan vielleicht noch 100 Leute sitzen.…
JONAS ZIPF: … mit eineinhalb Meter Abstand und Mundschutz. Vielleicht muss das Licht an bleiben, es darf nicht gedimmt werden. Ganz sicher kann die Garderobe nicht mehr abgegeben, sondern muss auf den Schoß gelegt werden. Es gibt keine Bewirtschaftung, keine Gastro. Man wird lange am Einlass und Auslass warten. Namen werden aufgeschrieben und so weiter. Das entspricht nicht derselben Atmosphäre, nicht demselben offenen und freien gesellschaftlichen Leben, was sich sonst mit Kultur verband. Kein Wunder, dass die Zahlen bei den Einrichtungen, die jetzt schon geöffnet haben – bei uns waren es auch zuerst die Museen – alles andere als eine V-Kurve zeigen. Alles andere als den von uns Kulturschaffenden gehegten Wunsch, dass die Leute nach der Zeit der Entbehrung wieder strömen. Da ist die Vorsicht, die Sie beschreiben, die mich auch immer noch hoffnungsvoll sein lässt, dass es weiterhin solidarisch zugeht. Aber da ist eben auch ein absolutes Loch, eine Leerstelle und eine Funktion, die vor Corona mit Kultur erfüllt war. Deswegen hat mich auch Ihre Betrachtung von Max Liebermanns Biergarten auf „Spiegel Online“ so beeindruckt.
Da steckt ein tiefer Sehnsuchtspunkt drin. Der hat sowohl zu tun mit diesem gesellschaftlichen Leben im Biergarten, als auch mit der künstlerischen Darstellung, die ja auch wieder auf ihre Art und Weise Gemeinschaft stiftet. Weil ich als Betrachter daran teilhabe, wie die dort im Biergarten zusammen sind, aber sich auch eine parallele Gemeinschaft im Museum versammeln kann. Aber ich persönlich bin mir unsicher, welche Rolle wir als Kulturakteure jetzt spielen sollten: Sollten wir eher die kollektive Sehnsucht mit fahlem Ersatz nähren oder uns eher zurückhalten und darauf warten, dass die Krise bewältigt wird, dabei aber unser Verschwinden riskieren?! Sollte man eher sagen, dass wir unter diesen Bedingungen nicht spielen – so, wie Helge Schneider, der sagt: „Ich spiele nicht vor Autos.“? Oder eher Präsenz und Kreativität beweisen und doch spielen? Eine Woche nach Helges Statement habe ich Heinz Rudolf Kunze gesehen, wie er in Erfurt vor Autos gespielt hat. Ein fast dystopisches Bild, das sich da im Kopf einbrennt.
BERNHARD MAAZ: Ja, aber wie gut ist das denn?! Es ist gut, dass der eine sagt: Nein. Und der andere sagt: Ja. Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann! Da sind wir mitten in den Diskurs gestürzt. Weil beide gut begründbare Haltungen zeigen… Entschuldigung, ich bin jetzt mitten in den Satz reingefallen.
JONAS ZIPF: …Nein. Wunderbar…
BERNHARD MAAZ: … ich finde es total spannend und richtig. Und wir im Museum haben gesagt: Wir brauchen drei Wochen Vorlauf. Dann durften, sollten, mussten wir aber sogar mit nur fünf Arbeitstagen Vorlauf wieder öffnen. Am Ende waren es sechs Tage… Und es war richtig, als Entscheidung, wenngleich hart in der Praxis. Das hat mit der Belegschaft und auch den Fremdfirmen ‚etwas gemacht‘: Wir sind plötzlich und endlich wieder auf ein Ziel zugegangen, und das hat Energie freigesetzt. — Jetzt springe ich nochmal zu Liebermann.
JONAS ZIPF: Gerne.
BERNHARD MAAZ: Ich war gestern im Biergarten am Wörthsee, fast 60 Kilometer vor den Toren der Stadt. Man ging dort mit einem Mundschutz hinein und setzte sich an einen Tisch und nahm den Mundschutz wieder ab: der Mundschutz als Placebo? Er ist eine Umsichtsgeste. Diese Geste eingeübt zu haben, ist richtig. Obwohl wir wissen, dass der Mundschutz uns nicht retten wird. Liebermanns „Biergarten“ bietet ein ähnliches Spiel zwischen Nähe und Distanz, zwischen Erwartung und Erfüllung. Was der Maler zeigt: Im Biergarten treffen sich alle. Da sind auch kleine Familien, fremde Leute, Kindermädchen. Es wird die ganze Gesellschaft in ihrer Heterogenität abgebildet; man sieht das. Es gibt Blickkontakte, Aktionskontakte, Kinderspiel, Distanzierung, gemeinsames Musizieren, die Begrüßungsgeste: Da wird der Hut gezogen. Man sieht, die Gesellschaft besteht aus vielen verschiedenen Einzelteilen. Und deswegen komme ich jetzt nochmal zurück auf die beiden Reaktionsweisen, „Ich spiele nicht vor Autos“ oder „Ich mache es halt dann doch“. Die Kunst und die Künstler und Künstlerinnen sind frei. Das bietet die große Chance, eigene Entscheidungen zu treffen, mit Sinn – oder sinnfrei. Dass das mitunter mit Hygienekonzepten kollidiert, ist eine andere Geschichte. Aber wir sind frei. Wir können sagen: „Ich mache keine Führungen, solange ich einen Mundschutz tragen muss.“ Und ein anderer kann sagen: „Ich mache Führungen, obwohl ich durch den Mundschutz zwar beim Sprechen behindert bin, aber weil ich meine soziale Nähe statt der sozialen Distanz leben kann.“ Wir haben uns dafür entschieden, wir machen das. Und wir haben auch mit den Förderkreisen der Museen schon früh die Personen ins Auge genommen, die als sogenannte „feste Freie“ – übrigens noch ein Paradox – für uns arbeiten. Bei der Wiederöffnung von Museen ging es neben anderem auch darum, denjenigen die Chance zu geben, wieder einzusteigen, die die Vermittlungsarbeit leisten. Die aktuelle Herausforderung ist es doch gerade, alle unterschiedlichsten Formen der Verantwortung im Auge zu behalten: Unsere Verantwortung für den Infektionsschutz und für unser Publikum, aber auch für unsere Mitarbeiter, feste wie freie.
JONAS ZIPF: Also, ich bringe das jetzt nochmal zusammen mit dem Bild. Da wird eine Gesellschaft gezeigt mit unterschiedlichen Gruppen. Das ist schließlich eine Frage der Vielfalt. So verstehe ich auch den Hinweis darauf, dass wir frei sind und dass der Diskurs entsprechend offen und dialogisch geführt werden kann. Vielleicht müssten wir daraus aber auch den Schluss ziehen, die Vielfalt, die sich bei uns durch unsere Angebote versammelt, den Diskurs, der bei uns, auf unseren Bühnen, in unseren Häusern geführt werden kann, jetzt besonders offensiv stattfinden zu lassen. Nicht einfach die Frage beantworten mit „Ja, ich spiele“ oder „Nein, ich spiele nicht“. Der eine spielt, damit die Veranstaltungswirtschaft – übrigens fast vergleichbar mit den Spielbetriebs-GmbHs der Fußball-Bundesligisten – wirtschaftlich die Zeit übersteht, damit überhaupt noch Umsätze fließen. Der andere kann es sich leisten, hat Rücklagen, so wie Helge Schneider, und sagt: „Ich spiele nicht mehr, und wenn es das letzte Mal gewesen ist, dass ich für euch gespielt habe.“ Das ist dann aber gar nicht der erhebliche Punkt. Sondern erheblich ist und bleibt, das haben Sie jetzt überzeugend stark gemacht, der Punkt der Freiheit der Kunst und der Freiheit des Diskurses. Dass diese Positionen gegeneinandergestellt werden können und dass wir die Gemeinschaft dadurch erlebbar machen, dass dort unterschiedliche Positionen aufeinanderprallen. Das würde bedeuten, dass man die Häuser genau für diese Diskussion jetzt auch öffnen muss. Dass man quasi dort Gruppen zusammenbringen muss, die sonst nicht zusammenkommen, und den Dialog durch die Krise hindurch weiter führt oder gar verstärkt.
BERNHARD MAAZ: Ja. Also… ich gebe mich dabei nicht der Illusion hin, dass wir die gesamte Gesellschaft erreichen werden. Die erreichen wir …
JONAS ZIPF: …auf gar keinen Fall…
BERNHARD MAAZ: … auf gar keinen Fall, ja. Aber ich habe diese Erinnerung: Wir alle haben mitbekommen, wie Igor Levit damit begann, jeden Abend im Netz zu spielen. Im zweiten Schritt wurde das von Bundespräsident Steinmeier gewürdigt. Er hat ihn ins Schloss Bellevue eingeladen, um dort zu spielen. Das haben wir alle mit größtem Respekt wahrgenommen. Weil da ein Junktim entstanden ist, das wir in der Gesellschaft leider oft vermissen: Nämlich dass ein Politiker nicht nur im Wahlkampf irgendwas für die Kultur sagt, sondern im regulären Leben etwas gibt, aktiv, sofort sichtbar. Denn letztendlich ist auch der Bundespräsident Bürger dieser Welt, und er hat verstanden und gezeigt, da gab es einen Künstler, der sich ganz stark geöffnet und nicht auf Profit geschaut hat, sondern der das Lebensmittel Musik verteilt, unter das Volk bringt. Und Bundespräsident Steinmeier hat das durch seine Einladung gewürdigt. Denn so eine Einladung ist eine riesige Auszeichnung.
Was wir gelernt haben sollten und was vielleicht im Auge bleiben muss, ist, dass die Verantwortlichkeit für die Kultur nicht nur bei der Kultur liegt, sondern eben natürlich auch im politischen Apparat. Und damit meine ich weitaus mehr als nur ein Ministerium, sondern ich meine den Souverän, das Parlament. Ich meine, dass diejenigen, die über die Verteilung von Mitteln auch in Zukunft reden und entscheiden dürfen und sollen und müssen, dass die erreicht werden müssten von dem, was die Kultur kann. Ich erinnere mich an die Lektüre eines wirklich eindrucksvollen Buches. „Das Hohe Haus“.
JONAS ZIPF: Sie meinen das Buch von Roger Willemsen, ja?
BERNHARD MAAZ: Genau. Auf Hunderten Seiten wird vom Bundestag berichtet. Und Kultur kommt dort nur ein einziges Mal und dann auch noch im rein wirtschaftlichen Kontext als Standortfaktor vor. Nun kann man sagen, Kultur ist Ländersache. Nein, Kultur ist Gesellschaftssache. Worum es mir geht, das ist, dass der Entscheidungsträger, die Länderparlamente und so weiter, sich dessen vielleicht noch stärker bewusst sein müssen, welche großartige Chance sie haben, die Kultur finanzierend und stärkend, die Gesellschaft zu gestalten… – …nicht nur mit Autobahnbau oder mit Militärausgaben, alles notwendig, keine Frage –, sondern auch im Blick zu behalten, dass dieses „Grundnahrungsmittel Kultur“ zur Gesellschaft dazugehört!
Es gibt den Begriff der Systemrelevanz. Ich habe gerade gestern Abend einen ganz kleinen Text dazu zu schreiben gehabt, für eine befreundete Kollegin und ihr Projekt. Ich habe dort den Zusammenhang hergestellt zwischen Systemrelevanz und Sozialrelevanz. Ich glaube, dass das Museum eine Sozialrelevanz hat, dass es besonders wichtig sein wird, nicht für das „System“ (das einfach „funktionieren“ soll), sondern für das Sozium, für den Menschen und für die Gesellschaft. Und das ist die Aufgabe, die uns aus der Krise heraus unversehens gestellt worden ist.
JONAS ZIPF: Jetzt muss ich eine Herausforderung beschreiben. Selbstverständlich bin ich als Kulturverantwortlicher bei Ihnen und finde in Ihrer Beschreibung eine schöne Übersetzung dieser sonst sehr selbstreferenziellen Diskussion, ob wir als Kulturschaffende systemrelevant sind oder nicht. Denn sozial-relevant sind wir auf jeden Fall. Über Gemeinschaft reden wir ja in diesem Gespräch die ganze Zeit. Jetzt will ich aber die Herausforderung beschreiben: Ich bin mir einig mit Ihnen, dass wir bei weitem nicht alle erreichen, möchte aber betonen, dass es unser Anspruch sein muss, möglichst viele zu erreichen.
BERNHARD MAAZ: Ja…
JONAS ZIPF: Der Ehrlichkeit halber gilt es doch, ein Spannungsfeld zu beschreiben: Zwischen künstlerischen Gütern, die sich einerseits schon seit vielen Jahrzehnten in einem Wettstreit der Avantgarde-Entwicklung befinden, andererseits aber mit ihrer Entwicklung, der ihr innewohnenden Dynamik und Eigenlogik, nicht immer kompatibel und kommensurabel für die Menschen „da draußen“ sind. Und das lässt sich nur sehr bedingt vermitteln und übersetzen mit pädagogischen, didaktischen Formaten. Denn das Tempo der Entwicklung ist einfach um viele Umdrehungen schneller, als es die Entwicklung von Hör- und Sehgewohnheiten sein kann. Und da stecken wir natürlich in einem Zwiestreit, da wir im Sinne der politischen Rechtfertigung, von der Sie jetzt gesprochen haben – und im Übrigen, nur nebenbei gesprochen, ist es natürlich ein zentrales Problem, das jetzt auch schmerzlich sichtbar wird, dass der Bund keine kulturpolitische Kompetenz hat! – nicht nur die soziale Relevanz beweisen, sondern immer auch die Kunst aus sich selbst heraus argumentieren lassen müssen. Darin besteht auch, wie ich finde, eine der Formen von unserer Verantwortung als Kulturverantwortliche: Die Verteidigung der Kunst, die auch sich selbst genug sein darf und eine eigene Wertigkeit besitzt aus der Tradition ihrer jeweiligen Sparten und Genres heraus. Das ist aber ein Punkt, der politisch viel schwerer durchzusetzen ist, weil man in ein derart polemisches Procedere einsteigt. Am Ende des Tages bekommt man vorgeworfen, dass man für kein Publikum oder nur noch für ein ganz kleines Publikum spielt. Und dann werden einzelne Kunstbereiche gegeneinander ausgespielt in einer unmöglichen Art und Weise. Aber ich würde diesen zweiten Pol der Argumentation für die öffentliche Bezuschussung immer und unbedingt stark machen. Und das vielleicht mal mit dem zweiten Kunstwerk begründen, das wir uns für heute vorgenommen hatten. Wir sprachen über eines aus Ihrer Sammlung, den „Biergarten“ von Max Liebermann. Jetzt sprechen wir über das andere aus unserer: „Die Rose für Demokratie“ von Joseph Beuys.
https://ein-kunsthaus-fuer-jena.de/2020/05/03/kunsthausfruehling-5
Dieses fragile Etwas stellt den Versuch von Beuys vor, beide Argumentationsmuster – das der sozialen Relevanz und der Kunst als Wert an und für sich – zusammenzuführen. Mit seinem Büro für direkte Demokratie wollte er auf der documenta tatsächlich mit den Mitteln der Kunst einen demokratischen Diskurs im Sinne einer direkten Demokratie erreichen. Darin folgt er einem Impetus und Impuls, der so viele politische Ansätze aus dieser Zeit geprägt hat. Es galt, die sogenannten „einfachen“ Leute zu erreichen. Man stand mit der Gitarre am Werkstor und wollte die Arbeiter für die linke Revolution gewinnen, merkt aber schmerzhaft, dass das hohe Ross der intellektuellen Avantgarde, auf dem man sitzt, unerreichbar hoch ist. Und bei Beuys kann man das wirklich zugespitzt beobachten. Was für ein großartiger gesamtgesellschaftlicher Ansatz es doch ist, zu sagen, jeder Mensch sei ein Künstler, alle Tätigkeiten können künstlerisch begangen werden! Und doch wurde das Diktum so missverstanden, wie es nur missverstanden werden kann, als abgehoben diffamiert und abgestempelt, obwohl Beuys damit etwas absolut Inklusives gemeint hat und wirklich in die Breite kommen und ganz viele Menschen erreichen wollte. Und das ist mit der Rose für Demokratie auch so. Anders als bei den Liedermachern am Werkstor, hält die avantgardistische Qualität ihren künstlerischen Bestand. Geblieben ist aber nur noch diese Abstraktion, das künstlerische Artefakt, und das absurderweise, als wäre es ein Treppenwitz, auch noch vom Kunstmarkt nobilitiert, als Objekt der betuchten Kunstsammler oder gar als Wertanlage. Wir sind ja jetzt kurz nach Pfingsten. Da hat die Rose ja auch nochmal eine besondere zweite und dritte Bedeutung. „A rose is a rose is a rose“[3] sozusagen: Wie beim Pfingstwunder gibt es einen kurzen Moment der Utopie und danach deren unwiederbringlichen Verlust. Abseits jeglicher theologischer Exegese beschreibt das Pfingstwunder ja im Grunde genau das Spannungsfeld, von dem wir die ganze Zeit sprechen: Nur für einen kurzen Moment wird eine aus einer Vielheit bestehende Gemeinschaft untereinander, miteinander sprechfähig, über Sprachgrenzen hinweg. Das ist ja das Tolle an diesem Pfingstwunder. Es gelingt, da mit dem Wunder von oben, hie aber vielleicht auch mit den Mitteln der Kultur, dass Menschen miteinander in Dialog, in Berührung und Begegnung kommen. Aber eben nur für einen kurzen Augenblick. Und dann möchte ich einfach dieses Konfliktfeld, diese Herausforderung schon beschrieben wissen, dass wir uns das gerne zum Ziel stecken können, aber dass wir, wenn wir ehrlich sind, in unserer Außenwahrnehmung starke Vorurteile gewärtigen, weil wir da einfach erst mal wirklich als elitär rüberkommen. Das müssen wir, glaube ich, selbstkritisch einräumen.
BERNHARD MAAZ: Ja. Das ist keine Frage. Gerade die Kunst der Moderne mit ihrer Abstraktion, ihren Formalismen, ihren installativen Arbeiten, denen man zuweilen gar kein handwerkliches Grundfundament mehr ansieht oder ansehen soll, hat immer wieder Angriffe auf sich gezogen. Das führte schon um 1911 zu öffentlichen, publizistisch ausgetragenen, letztlich nationalistisch motivierten Streitereien, als man gegen die französischen Impressionisten und die deutschen Museumserwerbungen ihrer Werke zu Felde zog. Das war in der Aktion „entartete Kunst“ ganz massiv und brutal der Fall. Es ging dann in den 1960er Jahren weiter, als die Bürger sagten, „so etwas“ könne doch jedes Kind malen. Will sagen: Der Rechtfertigungsdruck der künstlerischen Form war in der Moderne immer präsent. Und er wird uns auch weiter begleiten. Diesen Ablehnungsstrategien, die meistens aus dem Blickpunkt von simplifizierenden Weltbildern heraus kommen, wird man zwar begegnen können, aber die Menschen wird man kaum umstimmen können, allenfalls im Laufe von Jahrzehnten und Jahrhunderten: Das, was 1905 mit der Gründung der „Brücke“ in Dresden passierte, die Etablierung des deutschen Expressionismus, war 50 Jahre später endlich anerkannt. Und da wurde es dann von Vielen verstanden, gesammelt, geliebt. Also 50 Jahre für den Abbau von Vorbehalten, das ist in der bildenden Kunst wahrscheinlich ein Zeitraum, mit dem wir leben müssen. Das sind immerhin zwei Generationen.
Die Kunst wird immer eine gewisse Hermetik haben. Aber die Aufgabe der Museen und anderer ist es doch, diese Hermetik zu vermitteln, zu öffnen, zu überwinden. Was heißt das? Ich habe, bevor ich Dresden verlassen habe, ein Buch über die dortige Gemäldegalerie geschrieben. Das habe ich mir für unser Gespräch jetzt bereitgelegt, weil ich dachte, dass wir darauf zu sprechen kommen. Ich habe die Bilder der alten Meister vom Mittelalter bis um das Jahr 1800 besprochen, aber dabei immer gezielt auf die Frage geachtet, warum wir die alten Bilder überhaupt anschauen? Wir sollten sie anschauen, weil sie etwas mit uns zu tun haben! Und zwar nicht nur als Wissen, dass es Rembrandt gab, sondern als Bildung, Herzensbildung, emotionale Bildung und so weiter. Ich habe beim Schreiben dieses Büchleins immer auf eine bestimmte Abstraktionsebene geachtet, die uns heute diese Bilder erschließen kann, und dazu dann am Ende noch ein Register gemacht. So kann man nach den Künstlern schauen, aber man kann auch die Sachverhalte, die in der Kunst verhandelt werden, nachschlagen. Wenn ich das jetzt aufschlage und einfach Stichworte vorlese, wird deutlich, wie relevant, wie rezent die alte Kunst ist, aber auch, wie wirklich wichtig unsere Vermittlungsarbeit ist. Beispielsweise unter M: Macht, Machthunger, Machtlosigkeit, Machtmissbrauch, Mäßigung, Maßlosigkeit, Melancholie, Menschlichkeit, Misstrauen, Moral, Mord, Musik, Mut, Mütterlichkeit. Oder beim Buchstaben S: Sanftmut, Scharfsinn, Schmerz, Schönheit, Schuld, Schwäche, Seele, Selbstbild, Selbsteinschätzung, Selbsterkenntnis, Selbstgefälligkeit, Selbstgenügsamkeit, Selbstjustiz, Selbstkasteiung, Selbstkontrolle und so weiter. Das sind alles Themen, die in diesen Bildern berührt werden.
Wenn jemand in einer Führung im Museum diese Themen vermittelt, dann zeigt er oder sie den Betrachterinnen und Betrachtern, den Schülern, den Kindergartengruppen, was es mit Kunst auf sich hat, was sie uns sagen kann. Ich habe vor wenigen Jahren hier in München eingeführt, dass es vor zehn Uhr möglich ist, mit Kindergartengruppen und Schulklassen in das Museum zu gehen, ganz allein, zum ungestörten Reden über Kunst. Damit genau so was ungestört passieren kann: die Vermittlung der Werte, die „in den Bildern drinnen“ sind. Für die Moderne ist das sicherlich schwieriger, aber es ist nicht unmöglich. Wir wissen, dass ganz viele 20-Jährige, 30-Jährige zu uns in die Pinakothek der Moderne kommen. Es gibt diesen Hunger nach Kunst und nach dem Verstehen der Kunst. Also worum geht es bei dem Ganzen? Um Gemeinschaft, um Angebote, um den Diskurs, um die Werte. Das, was wir uns wünschen, dass der Kultur gerade jetzt und in Zukunft weitergehende, stärkere Unterstützung widerfährt. Es geht im Grunde um eine Perspektivierung. Utopie oder Dystopie, das ist hier die Frage.
JONAS ZIPF: Die Frage, ein Scheideweg, an dem wir tatsächlich stehen. Dessen Richtung sich anhand der Rolle entscheidet, die wir für die Konstitution von Gemeinschaft spielen, oder um bei Ihrem Begriff zu bleiben, welche Sozialrelevanz wir haben. Sie haben jetzt die Fäden des Gesprächs zusammengefügt. Immer wieder kommen wir auf den Punkt der Gemeinschaft zu sprechen. Aber mittlerweile auf eine wesentlich hoffnungsvollere Weise als zu Beginn unseres Gesprächs. Meine Stimmung hat sich zumindest maßgeblich verbessert, Herr Maaz, das muss ich sagen. Das ist ein archimedischer Punkt, auf dem das steht, was wir machen. Und wenn es uns gelingt, als Gemeinschaft durch diese Krise zu gehen, dann werden wir wahrscheinlich für diese gemeinschaftskonstituierenden Erlebnisse in der physischen Kopräsenz von Menschen, die sich treffen und begegnen, eine noch stärkere Grundlage haben. Und das müssen wir politisch durchsetzen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Das müssen wir stark machen.
BERNHARD MAAZ: Ja, das ist eine erhoffte Zukunft, politisch durchsetzen, den Radius erweitern und die Chancen nutzen, die hierin liegen. Das ist jetzt eine der größten Aufgaben, nicht die Erwerbung von noch einem Kunstwerk, sondern die Erläuterung der Notwendigkeit des Museums, des Theaters, des Konzertsaals, der Plattformen unserer Arbeit!
JONAS ZIPF: Ja genau. Das ist der perfekte Moment, um auf den Pausen-Button auf meinem Diktiergerät zu drücken und Ihnen zuzurufen: Pfiat Eana!
BERNHARD MAAZ: Servus!
[1] Bayerische Theaterakademie „August-Everding“, München
[2] Bundestagsdrucksache 17/12051, 3.1.2013.
[3] Gertrude Stein (1874 – 1946): Sacred Emily (1913, veröffentlicht 1922)

Professor Dr. Bernhard Maaz ist seit 1. April 2015 Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und damit der Leiter der drei Münchner Pinakotheken, der Sammlung Schack, der Sammlung Brandhorst und der 12 Staatsgalerien.
Wer hätte vor ein paar Wochen für möglich gehalten, dass unsere hektische Welt zum Stillstand kommen kann? Nun hat uns das Virus eines Besseren belehrt.
Liegt aber in dieser globalen Corona-Krise, in diesem erzwungenen Innehaltenmüssen auch eine Chance? Das liegt an uns, „was wir jetzt daraus machen“. Dieser Überzeugung ist Jonas Zipf und er suchte sich in der gesamten Bundesrepublik hochkarätige Gesprächspartner*innen, um dies auszuloten.
Ein wiederkehrendes Motiv sind dabei Feiertage oder Jahrestage: In den ersten beiden Corona-Gesprächen können Sie sich auf einen Osterspaziergang mit Hartmut Rosa begeben und den Gedanken zum Tag der Arbeit mit Thomas Oberender lauschen.
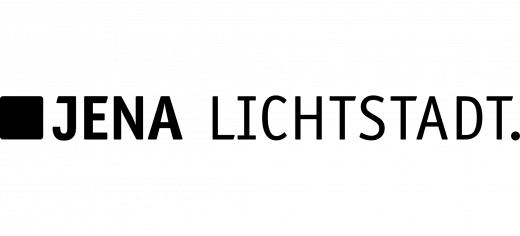

Ich habe wieder (wie immer) mit viel Interesse den Blogbeitrag gelesen und besonders Kipppunkt-Analyse , meiner Meinung nach, sehr präzise beschreibt was vorging und gerade vorgeht.
Das Gesprächsformat mit Rede und Gegenrede ist sehr lebendig und beleuchtet Problemstellungen sehr gut auf eine ganz eigene Weise. Denkanstöße inclusive….
Es ist immer spannend zu spüren , wie Gespräche auf Augenhöhe verlaufen und zu welchen Erkenntnissen dies fürhen kann.
Besonders die Bedeutung der Gemeinschaft hat mir gut gefallen, und der gemeinschaftskonstituierenden Erlebnisse, die aus meiner Sicht die ganze kulturelle Bandbreite beinhalten sollte und eben Toleranz voraussetzen, das wäre eine schöne Vision in Nach-Corona Zeiten, die es als solche Zeiten voraussichtlich nicht geben wird-jedenfalls nicht in der Form der VOR-Coraon Zeit !
Aber es gibt auch Chance für neue Formate und Ideen jenseits des Mainstream und sollten wir nutzen, wann wenn nicht jetzt?
Quicy Jones hat es mal so ausgedrückt , wobei man Jazz auch durchaus auch durch „berührende Musik“(oder so ähnlich…)
„Jazz hat die Kraft, Menschen ihre Unterschiede vergessen zu lassen und
zusammenzukommen. Jazz ist die Verkörperung einer Kunst, die überwältigend
negative Umstände in Freiheit, Freundschaft, Hoffnung und Würde verwandeln kann.“