Frank Döbert stammt aus Weißenfels und war zur Wende so alt wie ich heute, Mitte 30. Als kritischer Geist und wegen seiner langen Haare war er zu DDR-Zeiten von der Stasi überwacht worden und aufs berufliche Abstellgleis geraten. Der ehemalige Zeissianer fand nur noch auf dem Wertstoffhof einen Job. Nach dem Mauerfall wollte er eigentlich nochmal studieren, bekam aber eine Stelle als Redakteur bei der Ostthüringer Zeitung angeboten und blieb der Lokalpresse 26 Jahre lang als genauer Beobachter des gesellschaftlichen Lebens seiner Wahlheimat treu. Für die Probleme der Jugendlichen in Jena wurde er so zu einem wichtigen Sprachrohr. Und manchmal auch zum Vermittler mit der Polizei oder dem Stadtrat. Zu unserem Treffen im Paradiespark bringt Frank eine Einkaufstüte voll mit Fotos aus den Anfangsjahren des Kassablanca mit, fein säuberlich aufgeklebt, datiert und in Klarsichtfolien gesteckt. Hunderte Artikel, die er in den letzten Jahren über das Kassa geschrieben hat, hat er in zwei Fotoalben aufbewahrt und mitgebracht.
Frank, wenn man 1989 ein junger Mensch in Jena war und Lust hatte auf Party – was hatte man denn so für Optionen? Und hat man überhaupt Party gesagt damals?
Wahrscheinlich eher Fete als Party. Aber es ist nicht so, als wär es hier immer nur trist gewesen zu DDR-Zeiten. Es gab zum Beispiel das Kulturzentrum in Lobeda, damals KZ genannt, und auch das Volkshaus, wo gute Bands aufgetreten sind. DDR-Bands natürlich, aber darunter auch solche, die die sogenannte Westmusik nachgespielt, Pink Floyd, King Crimson etwa, und damit einen bestimmten Publikumsgeschmack bedient haben, zum Beispiel den von den Leuten mit den langen Haaren. Bei solchen Bands war natürlich die Bude voll. “Kundentreffen” nannte man das dann. Da sind alle aus Jena und der Umgebung hergekommen, es gab lange Tafeln und Tabletts voll Bier und Schnaps.
Klingt ein bisschen provinziell.
Ich habe seit den 70ern West-Schallplatten gesammelt, für viel Geld gekauft, eine Platte für 100 DDR-Mark, ein Doppelalbum für 180 Mark, man tauschte untereinander, überspielte die Platten auf Tonband. Manche Leute hatten Kontakte durch Westverwandschaft. Ich hab viele Platten in Budapest gekauft. Also man bekam schon ordentliche Musik zu hören, und einige Bands haben die dann auch nachgespielt.
Und ab 1990 konnte man dann auf einmal die Originale hören.
Als nach der Wende dann die Bands aus dem Westen kommen konnten, die man so aus der Ferne angehimmelt und imitiert hatte, war das für viele Musikfans eine logische Fortsetzung. Darauf hatten doch alle gewartet. Gerade die Punker, die waren ja praktisch wie Ausgestoßene, wurden von der Polizei verfolgt und so. Und als die DDR weg war, konnte jeder nach seiner Fasson selig werden. Die Jugendkultur wurde schnell viel differenzierter, auf einmal gab es alles: Ska-Fans, Skins, Gruftis, Punks, Metaller, Hippies. Und das Kassablanca war der Ort, wo diese Konzerte stattfanden.
Wenn man deine Konzertfotos so betrachtet – optisch ist das natürlich ein kleines Fest. Man sieht gefärbte Iros, Glatzen, schwarz geschminkte Männer und Frauen, Leder, Nietengürtel. Es ist auch ein bisschen ein Spiel mit Verkleidung. Woher kam dieser Impuls, sich so abzugrenzen?
Das fing ja in der DDR schon an. Die Normalos, die Spießbürger sahen diese Jugendlichen und konnten oft die Welt nicht mehr verstehen. Da kamen viele Jahre lang noch Sprüche wie: „Solche Leute hätten sie früher vergast, sowas hätte es bei uns nicht gegeben.“
Heftig. Aber für junge Menschen war die Wende trotzdem vor allem eine Zeit der neuen Freiheiten, oder?
Befreiung in jeglicher Hinsicht. Nicht nur musikalisch, auch im Äußeren, im Denken, in der Kunst, in jeglicher Richtung. Aber die Freiheit hatte auch eine Kehrseite. Tausende verloren ihre Arbeit. Ohne Geld und Perspektive war die Freiheit plötzlich nicht mehr so viel wert. Frust und Protest gehörten jetzt dazu. Und leider gab es auch immer mehr Nazis.
Mein Vater kaufte sich auch für viel Geld Platten in Budapest. Als ich anfing, mich für Musik zu interessieren, fand er es trotzdem wichtig mir zu sagen: Wenn du mit nem Ohrring nach Hause kommst, rupp‘ ich ihn dir raus. Wie sehr hingen denn Musikgeschmack oder Mode und politische Einstellungen zusammen?
Nicht so besonders, denke ich. Die angepasste Mehrheit hatte ab Anfang der 80er-Jahre zum Beispiel auch Jeans-Hosen für sich entdeckt, möglichst noch aus dem Westen. Früher bekamen junge Leute, die eine West-Jeans hatten, Schwierigkeiten in der Schule oder am Arbeitsplatz. Aber plötzlich war das ein Bekleidungsstück, mit dem man nicht mehr auffiel. Es sei denn, man machte es wie ich und garnierte das Ganze mit langen Haaren, Jesus-Latschen und sowas, dann hat man sich abgehoben. Aber das wurde immer schwieriger, denn wie das heute auch ist, die modischen Stile wurden von der Masse kopiert. Und dann hat man sich eben durch andere Sachen versucht abzuheben, indem man auf besondere Weise getanzt hat zum Beispiel, oder durch rumpöbeln. Heute ist das viel gemäßigter.
Da klingt auch etwas Bitterkeit mit durch. Was hat dieses Anderssein für dich für Auswirkungen gehabt als junger Mensch?
Ich habe meine Arbeit im Zeiss-Werk im Prinzip nur verloren, weil ich lange Haare hatte. Die Stasi fragte Leute über mich aus und kategorisierte mich dann als „Heavy Metller.“ Ich wurde arbeitslos, ein „Asozialer“ in der Sprache der DDR. Man hat es vor allem auch im ganz normalen Alltag zu spüren bekommen, wenn man abwich von dem, was als normal galt. „Zieh dich mal ordentlich an“, war ein Spruch, den haben nicht nur deine Eltern gebracht, sondern auch einfach Leute auf der Straße oder auf Arbeit. Man war im Grunde immer ausgestoßen, eine Randfigur. Das hat die Polizei so gesehen und die Staatssicherheit, und der normale Bürger hat sich dem angepasst. Alle wollten unauffällig normal sein.
Also du hast dich gleich sehr wohl gefühlt im Kassa?
Das kann man so sagen.
Man sieht an deinen Fotos, wie nah dran du bist an Künstlern und Publikum als Reporter. Heute ist das nur selten möglich, das Misstrauen gegenüber der Presse viel größer.
Ich war ja auch nicht nur zu Konzerten da. Wenn es Probleme gab, dann hat der Verein, der hinter dem Kassa steht, immer versucht, die Öffentlichkeit herzustellen und miteinzubinden, und da wurde ich mit der Zeit zu einem Sprachrohr.
Welche Probleme waren das?
Lange Jahre war die Finanzierung ein Kampf. Es gab kein Verständnis dafür in der Stadt, warum das Kassa mehr Geld bekommen sollte als andere Einrichtungen wie zum Beispiel der Rosenkeller oder das Volkshaus. Das hing aber damit zusammen, dass das Kassa eben nicht nur Konzerte machte, sondern von Anfang an auch soziokulturelle Jugendarbeit, es haben viele Randgruppen dort ein Zuhause gefunden, und es sind auch viele Jobs geschaffen worden. Es hat ein paar Jahre gedauert, das zu verstetigen und nicht immer nur von Jahresfinanzplänen abhängig zu sein. Es ging da ja auch um viel Geld. Jedenfalls ist es eine Aufgabe für mich geworden zu vermitteln, was dort im Kassa passiert, wie viel da auch in Eigenleistung saniert und repariert wird, damit eben auch die normalen Bürger und die Stadtverwaltung sehen können, dass da nicht nur auf Geld gewartet wird, sondern dass die wirklich was machen. Das war mir ein Anliegen, und bei der Zeitung gab es auch niemanden anderen, der darüber geschrieben hätte.
Die alternative Szene in Jena hat sich ja nicht nur auf das Kassablanca beschränkt, auch die Junge Gemeinde in der Stadtmitte spielte da eine ganz große Rolle. Viele von den Leuten, die sich in der Gesellschaft – damals wie heute – nicht zurechtfinden, haben dort eine Heimstatt gefunden, und oft auch eine berufliche Perspektive. Das Kassa ist ja auch ein Lehrbetrieb, der nicht nur einfach irgendwas anbietet, sondern in dem sich die Jugendlichen mit dem beschäftigen können, was sie interessiert. Technische, soziale, aber auch künstlerische Fähigkeiten konnten dort ausprobiert werden. Bis heute ist das Kassablanca auch ein Betrieb, der viele Menschen beschäftigt, und ihnen ein Leben ermöglicht hat, was sie sonst nicht hätten haben können. Das ist schon außergewöhnlich.
Projekte wie das Kassa gibt es auch in anderen Städten. Dennoch ist die Solidarität unter den Kulturschaffenden in Jena etwas Besonderes, und die dauerhafte Unterstützung für diesen Verein und den Club sucht zumindest in Ostdeutschland ihres gleichen. Was ist besonders an Jena?
Man braucht natürlich Kommunalpolitiker, die ein Verständnis dafür haben. Und die auch erklären können, dass es tatsächlich einen Bedarf für eine solche Einrichtung gibt, dass die auch Geld braucht und gefördert werden muss, und der Stadtgesellschaft auch etwas zurück gibt. In Jena gab es sicherlich günstige personelle Konstellationen, die das relativ schnell möglich gemacht haben. Aber das wäre nicht gegangen, wenn das Kassablanca sich nicht selber einen guten Ruf verschafft hätte. Jena hat sicherlich den Vorteil, eine Studentenstadt zu sein, in der der Anteil junger Menschen wesentlich größer ist als in einer normalen Stadt. In Jena hat sich das gesellschaftliche Denken nach der Wende explosionsartig entwickelt. Alternative Schulformen, Umwelt-, Schwulen- und Frauenbewegungen zum Beispiel spielten neben der Jugendarbeit auch eine große Rolle dabei. Über Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigten, fanden sie durch Wahlen dann auch ihren Weg aus der Breite der Bevölkerung hinein in die Gremien der Stadtpolitik. Dadurch haben sich Chancen ergeben, die es in anderen Städten, wo die speziellen Bedürfnisse einiger Bevölkerungsteile eben weniger Rücksicht und Aufmerksamkeit erfuhren, so nicht gegeben hat.
Hat das Kassablanca von der Bürgerrechtsbewegung profitiert, die zu DDR-Zeiten in Jena größer war als in anderen Städten?
Ich denke schon. Vor der Wende gab es wie erwähnt starke Repressionen durch die Polizei und die Stasi gegen Andersdenkende. Mit Roland Jahn, Jürgen Fuchs, Matthias Domaschk und anderen hat es in Jena aber auch viele relativ bekannte Oppositionelle gegeben, die viele andere ermutigten, sich aufzulehnen und in Gruppen zu organisieren. Die Stadt war sicherlich auch dadurch ein Sonderfall.
Woran machst du das fest?
Zum Beispiel am Umgang mit dem besetzten Haus, das es ja bis heute in direkter Nachbarschaft zum Kassa gibt, und in dem mittlerweile Menschen in dritter Generation leben. Als Jugendliche dieses Haus im Mai 1994 besetzten, gab es nicht nur – wie auf andere Treffpunkte alternativer Jugendlicher ebenfalls – regelmäßig Überfälle von Nazis. Auch die Polizei wurde eines Samstags mal von einem Wachdienst herbeigerufen, der die Besetzung bemerkt hatte. Weil gerade ein Fußballspiel mit hohem Polizeieinsatz in der Stadt gewesen war, standen dann plötzlich etwa zwei Dutzend Mannschaftswagen vor der Tür, und die Beamten wollten mal eben aufräumen. Ich war damals als Reporter vor Ort, und da ich schon einige Male über übertriebene Polizeieinsätze gegen die alternative Szene berichtet hatte, kannte man mich als kritischen Berichterstatter. Man mochte mich nicht unbedingt, aber als Zeitungsvertreter konnte ich als Vermittler auftreten.
Das klingt ja nach einer dramatischen Situation. Was hast du denn der Polizei gesagt?
Dass es hier eine politische Lösung braucht und es nicht damit getan sein kann, diese Jugendlichen aus dem Haus zu holen und anzuzeigen, denn in ein paar Tagen wären sie wieder da. Und da hat es bei allen Beteiligten geklickt an dem Abend. Der Jugenddezernent der Stadt, Stephan Dorschner, wurde dann angerufen, und kam zwei Stunden später auch, kreidebleich. Er kandidierte zu der Zeit gerade für die CDU zur Wahl des Oberbürgermeisters. Politisch gab es für ihn da gar nix zu gewinnen, viele Politiker scheuten sich vor solchen Konflikten. Er war aber wirklich in Ordnung und merkte auch, dass es so nicht weitergehen konnte. Die Jugendlichen durften bleiben – bis heute. Es gibt wirklich nicht viele Städte, in denen das so gut gelaufen ist.

Das Kassa feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag! Ein Jahr lang werde ich mich als Stadtschreiber mit den Menschen treffen, die diesen einzigartigen Verein und Club geprägt haben, und ihre Erinnerungen aufschreiben – und natürlich mit Ihnen/dir teilen, hier auf diesem Blog, auf Facebook und Instagram.
Welche Geschichten und Erinnerungen verbinden Sie/verbindest du mit dem Kassablanca? Haben Sie/ hast du noch irgendwo alte Fotos von Ihnen/dir und Ihren/deinen Freunden im Kassa? Ich freue mich auf Post an: allesgute@kassablanca.de
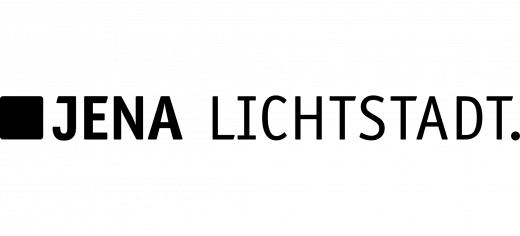


Ein kleines Gedicht zum Thema
HIPPIES IN DER DDR
Es war’n die wilden Siebziger Jahre,
Als wir hatten noch allzuviel Haare;
Blueser und Tramper, immer auf dem Pfad,
Hippies im Arbeiter – und Bauernstaat.
Jesuslatschen oder Kletterschuhe,
Blue Jeans, Parka und immer die Ruhe;
So ging’s am Wochenende in die Spur,
Musik und Freiheit das Ziel jeder Tour.
Man lauschte intensiv Freygang bis Renft,
Die Plätze vor der Bühne stets umkämpft.
Der Alkohol war immer mit im Spiel,
Man rauchte Karo und trank vielzuviel.
In den Fünfzigern kam der Rock’n’Roll,
Was Eltern schockte, fanden Teenies toll.
Die Sechziger brachten die Beatmusik,
Flower Power führte ins Hippie-Glück.
Im Osten war die Musik Klassenkampf,
Man machte Rockgruppen gehörig Dampf.
Sie galten als westliche Sendboten,
Restriktionen und Auflösung drohten.
Auch Ost-Hippies verehrten Blues und Rock,
Blickten sehnsüchtig aufs ferne Woodstock.
Stets im Visier von Stasi und Staatsmacht,
Pflegte man auch hier Liedgut und Haarpracht.
Man besorgte sich eine Gitarre,
Wollte niemals tragen eine Knarre,
Hasste Uniform und Kasernenmief,
Give Peace a Chance war immer Leitmotiv.
Urige Songs von den Doors bis Neil Young
Setzen Lust und Endorphine in Gang.
Wir sahen Modesünden, manchen Tick,
Was bleiben wird, ist die feine Musik.
Rainer Kirmse , Altenburg
Herzliche Grüße aus der Skatstadt